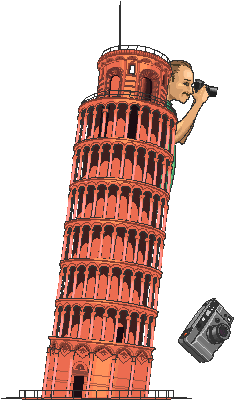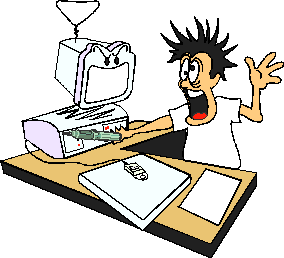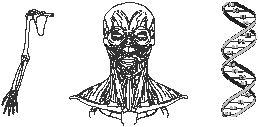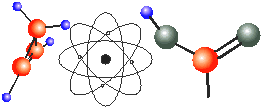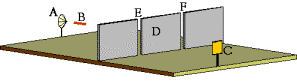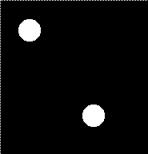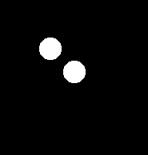|
Quantenphysik und Freier Wille G. Heim,
Aachen Der Gott, der mir im Busen wohnt, Johann Wolfgang von Goethe Inhaltsverzeichnis 2 Begriffseinengung: was ist ein freier Wille 2.1 Freiheit des Willens in der Wahl des Zieles 2.2 Freiheit des Willens in der Umsetzung 3 Freier Wille und das Weltbild der klassischen Physik 4 Die Quantenphysik schafft neue Interpretationsräume 4.3 Der Welle-Teilchen Dualismus 5 Freier Wille und Quantenphysik: das Bewusstsein 6.3 Karl Popper und John Eccles 7 Persönliches Fazit: ein neues Weltbild? 1 EinführungSeitdem die Quantenphysik Ende der 1920er Jahre von führenden Naturwissenschaftlern weitgehend anerkannt wurde, gibt es immer neue Versuche sie in die Diskussion über die Freiheit des Willens einzubinden. In diesem Referat soll gezeigt werden warum. Zunächst einmal wird in Kapitel 2 der Begriff des freien Willens beschrieben. In Kapitel 3 geht es um die Schwierigkeiten, das Weltbild der klassischen Physik mit der Vorstellung eines freien Willens zu vereinen. In Kapitel 4 werden dann, losgelöst von der Frage der Willensfreiheit, wesentliche Aspekte der Quantenphysik beschrieben. Kapitel 5 behandelt die Frage, welche Rolle das Bewusstsein im Themenverbund Quantenphysik und freier Wille einnimmt. Kapitelt 6 stellt beispielhaft drei philosophisch motivierte Interpretationen der Quantenphysik vor. Und Kapitel 7 letztendlich zieht ein Fazit und deutet ein spekulatives Weltbild zur Vereinigung von Willensfreiheit und Naturwissenschaft an. 2 Begriffseinengung: was ist ein freier WilleIn diesem Referat geht es um quantenphysikalische Phänomene in ihrem Bezug zu einem freien Willen. Was aber überhaupt ist ein Wille und wovon soll dieser frei sein? Was Wille ist lässt sich nicht in der Terminologie der Naturwissenschaften beschreiben. Man muss auf geisteswissenschaftliche beziehungsweise umgangssprachliche Wörter zurückgreifen womit jeder Versuch einer Definition mehr oder minder interpretationsoffen bleibt. Für die vorliegende Arbeit wird Wille wie folgt charakterisiert: Wille ist ein Empfinden welches die Herbeiführung oder den Erhalt eines bestimmten Zustandes der physikalisch realen oder der geistig erlebbaren Welt zum Gegenstand hat. Es kann der Wille eines Politikers sein, dass seine Partei eine anstehende Wahl gewinnt. Ein Bahnreisender kann den Willen haben, pünktlich am Zielort anzukommen. Ein Kind kann einen Kaugummi wollen und ein Hund kann mit einem Ball spielen wollen. Problematisch wird der Begriff des Willens wenn man ihn objektivieren will. Was man selbst will, dass ist in der Regel mehr oder minder klar (glaubt man). Wie aber kann man sicher überpüfen, inwiefern ein anderer Mensch, ein Tier oder ein unbelebter Gegenstand einen Willen hat? Kann man im Rahmen des Instinktverhaltens von Hühnern nach Körnern zu picken von einem Willen zum Körneressen sprechen? Hat eine Amöbe den Willen, sich auf mögliches Futter hinzubewegen? Kann man einem computerbasierten Verkehrsleitsystem einen Willen zu einem möglichst reibungslosen Verkehrsfluss unterstellen? Ist es der Wille eines psychisch kranken Menschen sich mit einem Messer zu verletzen? Diese Fragen müssen hier unbeantwortet bleibt und es muss darauf vertraut werden, dass die obige Definition von Willen als ausreichend scharf empfunden wird. Bleibt zu klären was unter „frei“ zu verstehen ist. Ein Wille wie oben beschriebenen kann denkbare Freiheiten bezüglich verschiedener Dinge haben. 2.1 Freiheit des Willens in der Wahl des ZielesEin Wille könnte frei sein bezüglich dessen was er will. Ob sich der Wille eines Menschen vorrangig auf die berufliche Karriere richtet oder eher auf das Familienleben, das könnte frei sein von Beeinflussungen außerhalb des Willens. In diesem Fall stellt sich aber die Frage, wer oder was den Inhalt oder den Gegenstand des Willens auswählt: was ist die Quelle des Willens? Wer will, was der Wille will? Hier droht ein endloser Regress! Und es stellt sich auch die Frage danach, ob innerhalb eines Menschen stets nur ein eindeutiger Wille vorhanden ist oder ob sich die Psyche eines Menschen aus zum Beispiel konkurrierenden Willen zusammensetzen könnte. Einige Beobachtungen lassen Zweifel daran aufkommen, dass ein Mensch tatsächlich vollständig wollen kann was er will:
Diese Beispiele legen nahe, dass der Wille eines Menschen durch materielle Zustände seiner Hirnzustände oder der Umwelt beeinflusst werden kann. Dies bewegt einige Menschen zu der Annahme, dass der Wille, den wir in unserem Bewusstsein wahrnehmen, bloß eine Begleiterscheinung, ein Epiphänomen, materieller Zustände sei und sonst nichts. Bleibt noch zu klären, wer das Subjekt des Willens ist. Menschen verrichten viele Dinge im Alltag ohne sich derer bewusst zu sein. Wenn ein Mensch vollkommen unbewusst, weil reflexgesteuert, eine Fliege totschlägt, hatte er dann einen Willen dies zu tun? Oder ist bewusstes Erleben eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt von Willen reden darf? Diese Frage reisst wieder an, wer oder was denn eigentlich die Quelle von Willen sei und führt weiter zu der Frage, was denn menschliche Individualität sei. Die Frage muss hier unbeantwortet bleiben und es soll genügen, die Problemstellung selbst aufgezeigt zu haben. 2.2 Freiheit des Willens in der UmsetzungDas Aufkommen eines Willens ist nicht identisch mit dem Erreichen seines Zielgegenstandes. Zwischen dem Enstehen eines Willens und der Umsetzung seines Inhaltes können mehr oder minder beeinflussbare Schwierigkeiten auftreten. So kann die Erfüllung eines Willens aus logischen Gründen heraus unmöglich sein: Es ist aus logischen Gründen heraus nicht möglich, dass irgendein Wesen einen Kreis erzeugt in dem pi=4 ist. Die Umsetzbarkeit eines Willens kann aber auch durch erfahrungsmäßige, das heisst empirisch erfassbare, Gesetzmäßigkeiten erschwert werden. Erfahrungsgemäß, aufgrund von Naturgesetzen, verbrennt man sich die Finger, wenn man an eine heiße Herdplatte greift. Inwiefern ein Wille hieran etwas ändern kann ist zweifelhaft. Denn: kann sich ein Wille über Naturgesetze hinwegsetzen? Oder: kann ein Willen nur dort frei sein, wo Naturgesetze den Ablauf der Wirklichkeit nicht vollständig regeln? Es ist diese Freiheit des Willens von den empirisch begründeten Naturgesetzen die in diesem Referat vorrangig betrachtet wird. Im folgenden Kapitel wird dieser Aspekt vertieft. 3 Freier Wille und das Weltbild der klassischen PhysikVerläßt man heute die Schule, ganz gleich mit welchem Abschluß, nimmt man in der Regel das Weltbild der klassischen Physik mit ins weitere Leben. Das heißt, man darf dann glauben, für jede ausreichend genau dargestellte Situation in der Realität gäbe es Formeln zur Vorausberechnung der weiteren Entwicklung. So gibt es Formeln die uns genau sagen, wie schnell ein aus einem Flugzeug geworfener Stein nach zwei Sekunden ist und welche Strecke er bis dahin zurückgelegt hat. Es gibt Formeln zur Vorhersage von Sonnenfinsternissen, Formeln zur Beschreibung der Ausbreitung von elektromagnetischen Feldern und Formeln zum Berechnen der Flugbahn von Mond- und Marsraketen. All diese Formeln gestatten kein Wenn und Aber, sie funktionieren einwandfrei. Jede Formel liefert stets ein exaktes Ergebnis und dies wird in der Realität so auch eintreffen. Messergebnisse und sonstige Beobachtungen bestätigen die Gültigkeit der Formeln. Innerhalb dieser naturwissenschafltichen Formeln taucht nirgends ein Wille als beeinflussender Faktor auf. Hierzu zwei Beispiele.
Die Erfolge der Naturwissenschaften im 18. und insbesondere im 19. Jahrhundert bei der Beschreibung von Abläufen der unbelebten Welt bestärkten die Vorstellung, dass die gesamte Natur, ganz gleich ob belebt oder unbelebt, vollständig durch Formeln oder auf ähnliche Weise fassbare Gesetzmäßigkeiten beschreibbar sei. Demnach seien alle real stattfindenen Abläufe vollständig durch Naturgesetze bestimmt, das heißt determiniert. Als methodische Leitlinie der Forschung genoss das Paradigma des Reduktionismus einen hohen Stellenwert: Gebilde der Realität sind demnach so zu unterteilen, dass die definierten Einzelteile möglichst vollständig durch bekannte Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben seien. Man reduziert sozusagen den Betrachtungsgegenstand auf eine Menge von Teilen, die möglichst wenigen Kategorien angehören und zwischen den ausschließlich gesetzmäßig bekannte Wechselwirkungen existieren.
Mit der Tiefe der Betrachtung sinkt also die Anzahl der zu unterscheidenden Elemente. So spricht man heute davon, dass die gesamte physikalisch erfassbare Welt letztendlich aus einigen wenigen Strings und ingesamt nicht mehr als 4 Grundkräften bestehen könnte. Im Paradigma des Reduktionismus wäre es demnach möglich, das Verhalten eines Menschen vollständig zu beschreiben, wenn man nur alle Grundbausteine und alle zwischen ihnen geltenden Gesetze kennt. Neben dem Reduktionismus als heuristischen Leitfaden ruhte das Weltbild der klassischen Physik auch auf einigen idealisierenden Grundannahmen mit ontologischer Relevanz. Dies war vor allem hinsichtlich einer Mathematisierbarkeit der Naturwissenschaften nötig. Zum einen wurde unterstellt, dass sich Masse für mechanistische Betrachtungen auf ausdehnungslose, mathematische Punkte reduzieren lassen könne und zum zweiten wurde die Stetigkeit aller Abläufe angenommen. Stetigkeit heisst, dass zwischen zwei beliebigen Zuständen immer noch mindestens ein weiterer Übergangszustand existieren muss. Bewegt sich etwa eine Kugel auf einer bestimmten Bahn, so gibt es keine zwei Punkte dieser Bahn, zwischen denen die Kugel plötzlich unter Auslassung von Zwischenpunkten springen würde. Wie bereits der griechische Philosoph Zenon zeigte, vermag diese zunächst einfache Grundannahme unsere Vorstellungskraft schnell zu strapazieren. Als letzte Grundannahme der klassischen Physik sei noch das Kausalitätsprinzip erwähnt. Demnach geschieht in der Natur nichts ohne Grund. Alles was passiert hat seine Ursache in der Natur selbst. Die gesamte Natur ist ein dadurch vollständig determiniertes Kausalgeflecht. Aufgrund der beachtlichen Erfolge der Naturwissenschaften über die letzten drei Jahrhunderte hinweg wurden die Grundannahmen der Wissenschaftler zunehmend unkritisch als ontologisch zutreffende Eigenschaften der Welt betrachtet und nicht mehr als zunächst aus pragmatischen Gründen gewählte Arbeitshypothesen. In einem solchen Weltbild nun, kann ein Wille keinerlei Freiheit in der Umsetzung besitzen. Wenn sich tatsächlich alle realen Gebilde in letztendlich elementare Grundbausteine zerlegen lassen und diese elementaren Grundbausteine in ihrem Verhalten ausschließlich eindeutigen Naturgesetzen gehorchen, dann wäre die Wirkung eines freien Willens nur daran zu erkennen, dass gegen bekannte Naturgesetze verstossen würde. Hierfür aber, so der Kenntnisstand bis etwa 1900, gab es keine ernstzunehmenden Indizien. Hinsichtlich der Freiheit des Willens in seiner Entstehung macht das Weltbild der klassischen Physik jedoch keine so strenge Einschränkung wie bezüglich einer Umsetzung des Willens. Solange ein Wille nicht mit der materiellen Welt wechselwirkt kann er den Naturgesetzen auch nicht widersprechen. Insofern macht das Weltbild der klassischen Physik keinerlei Aussage dazu, wie ein Wille entstehen könnte oder wie nicht. Es fällt aber auf, dass viele Bewusstseinsinhalte, darunter auch unser Empfinden von Willen, eng korrelierbar sind mit materiellen Zuständen des Gehirnes. So formulierten dann doch viele Naturwissenschaftler die Hypothese, dass Wille ein bloßes Abbild materieller Abläufe sei. Unser klassisches Verständnis der Physik verbietet also einen in seiner Wirkung freien Willen und ein in seiner Entstehung freier Wille ist für dieses Weltverständnis ohne Bedeutung. Halten wir an dieser Stelle nun fest, auf welchen Grundannahmen jene klassische Physik beruht die einen freien Willen höchstens als wirkungsloses psychisches Phänomen neben sich dulden würde:
Diese Grundannahmen der klassischen Physik sind insbesondere wichtig für die Abbildung der Realität in mathematischen Modellen. Und jeder Zweifel an einer dieser Grundannahmen berechtigt zu Zweifeln an der Gültigkeit des gesamten Weltbildes der klassischen Physik. Genau solche Zweifel aber brachte die Quantenphysik hervor. 4 Die Quantenphysik schafft neue InterpretationsräumeUm die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die Physik bei der Betrachtung von Atomen angelangt. Im Sinne des Reduktionismus wurde die Realität in immer kleinere Betrachtungsgegenstände zerlegt und man hoffte die Anzahl der zur Beschreibung der Natur nötigen Gesetze dadurch weiter reduzieren zu können. Dann geschah Unerwartetes: Max Planck untersuchte die Strahlung, welche von festen Körpern ausging und versuchte sie formelmässig zu beschreiben. Dies gelang ihm aber erst, nachdem er eine wesentliche Grundannahme der klassischen Physik aufgab: die Stetigkeit der Ereignisse. Erst als Planck annahm, dass Strahlung nur in nicht mehr teilbaren kleinsten Paketen emittiert werden kann, ließ sich das beobachtete Verhalten korrekt beschreiben. Die Quantenphysik war geboren. Innerhalb von nur 30 Jahren wurde dann eine vollkommen neue Betrachtung der physikalischen Realität entwickelt, die sogenannten Quantenmechanik oder Quantenphysik. Das revolutionäre an der Quantenphysik war die Aufgabe wesentlicher bis dahin gütliger Grundannahmen der Physik:
Damit wurde das bis dato gültige deterministische Weltbild wirksam in Frage gestellt. Bevor aber im nächsten Kapitel darauf eingegangen wird, in welcher Beziehung quantenphysikalische Betrachtung zur einem freien Willen stehen, soll zunächst das Wesen der Quantenphysik anhand von Beispielen erläutert werden. 4.1 Das Doppelspaltexperiment
Das Doppelspaltexperiment zählt zu den klassischen Experimenten zur Vorführung von Eigenarten der Quantenphysik. Abweichend von der üblichen Darstellung wird hier eine besonders einfache aber auch anschauliche Version dargestellt.
Ein Lampe A sendet hypothetische Lichtteilchen B, sogenannte Photonen, aus: und zwar eines nach dem anderen. Die Teilchen können die Lampe in jede beliebige Richtung verlassen, keine Richtung ist durch die Versuchsanordnung bevorzugt. Zwischen der Aussendung von zwei Teilchen wird soviel Zeit gelassen, dass die beiden Teilchen wegen ihrer hohen Geschwindigkeit auf ihrem Weg ganz sicher nicht miteinander wechselwirken können. Ein Detektor C kann registrieren, ob ein Lichtteilchen an ihm angekommen ist oder nicht. In einem ersten Versuchsdurchlauf werden beide Spalten E und F offen gehalten und es werden 1000 Teilchen der Reihe nach auf die Reise geschickt. Die Anzahl der am Detektor eintreffenden Teilchen wird notiert. Nehmen wir einmal an, von den 1000 Teilchen kämen 3 am Detektor an. Der Versuchsdurchgang wird nun ausreichend oft wiederholt, sodass der Anteil der im Detektor eintreffenden Teilchen mit einer gewissen statistischen Zuverlässigkeit festgehalten werden kann. In einem zweiten Versuchsdurchlauf wird nun einer der beiden Spalten vollständig geschlossen. Wieder werden 1000 Teilchen der Reihe nach hintereinander ausgesendet und wieder wird der Durchlauf mehrfach wiederholt um eine ausreichende statistische Sicherheit zu erlangen. Das Ergebnis ist verblüffend: Bei geeigneter geometrischer Anordnung und nur einem geöffneten Spalt kommen deutlich mehr Teilchen am Detektor an, als wenn beide Spalten offen sind. Sagen wir einmal, es kommen jetzt 75 von 1000 Teilchen an. Man muss versuchen, diesen Befund unter der Annahme der Grundpfeiler der klassischen Physik zu interpretieren: Ein Teilchen verlässt die Lichtquelle A und fliegt zufälligerweise durch den Spalt E. Irgendwie beeinflusst nun die Tatsache, ob der Spalt F offen ist oder nicht die Wahrscheinlichkeit des Teilchens, im Detektor C anzukommen! Aber wie soll das gehen? Weiss das Teilchen um den Spalt F obwohl es durch den Spalt E fliegt? Gibt es eine im Hintergrund vermittelnde Instanz die das Teilchen führt und ist es diese Instanz die um die geometrische Anordnung des Versuches „weiß“? Die Frage ist bis heute ungeklärt. Eine mathematische Beschreibung dessen was passiert beinhaltet die gesamte Geometrie der Versuchsanordnung. Und: diese mathematische Beschreibung macht nur statistische Aussagen. Die bekannten Formeln sagen nur aus, welche Anteile von Teilchen im Detektor ankommen, nicht aber, ob ein einzelnes Teilchen den Weg zum Detektor nimmt oder nicht. Dieser Versuch greift das Weltbild der klassischen Physik an zwei Punkten an: zum einen unterstellt es, dass ganzheitliches „Wissen“ über die geometrische Anordnung des Versuches vorhanden ist und dieses die Ankunftswahrscheinlichkeit des Teilchens am Detektor beeinflusst. Für dieses „Wissen“ gibt es aber keine bekannte Kraft oder ein sonstiges Medium der Informationsübertragung welches dafür in Frage käme. Zum zweiten treffen die erstellten Formeln der Quantenphysik lediglich statistische Aussagen. Sie lassen das Einzelgeschehen vollkommen offen und entheben es somit den Kausalgesetzen. Es gibt nichts determinierendes in den Formelwerken was einem Teilchen vorschreibt, wo es als nächstes beobachtet werden kann und wo nicht. Für einzelne Teilchen kann man nur Wahrscheinlichkeiten angeben, was sie als nächstes tun. Die letztendliche Entscheidung was ein Teilchen tut, liegt aber außerhalb des Regelungsanspruches quantenphysikalischer Formeln. Korrigieren wir unser physikalisches Weltbild aber dahingehend, dass wir den Gültigkeitsanspruch von Formeln reduzieren, so schaffen wir damit interpretationsoffene Räume: Räume, in denen konkrete Einzelereignisse geschehen, für die wir keine konkreten Einzelursachen angeben können, Freiräume also für einen freien Willen. 4.2 Die UnschärferelationDie Quantenphysik entstand an der Betrachtung kleinster Teilchen: Photonen, Elektronen, Protonen etc. In den 1920er Jahren kam man zu der Erkenntnis, dass man den Zustand solcher Teilchen nicht mit beliebiger Genauigkeit und Vollständigkeit messen kann: Je genauer man zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Teilchens erfassen will, desto ungenauer muss zwangsläufig die Messung des Impulses ausfallen. Und je genauer man den Energiezustand eines Teilchens misst, desto größer muss der Zeitraum sein, über den man die Messung vornimmt. Es gibt eine Reihe solcher Messgröße deren Produkt in der Genauigkeit einer Messung begrenzt ist. Mathematisch wird dieser Umstand in der „Unschärferelation“ zum Ausdruck gebracht: der Messfehler der einen Größe multipliziert mit dem Messfehler der anderen Größe muss größer als einem bestimmten Vielfachen des Planck`schen Wirkungsquantums (eine Naturkonstante) sein. Es gibt nun verschiedene Interpretationsrichtungen was den ontologischen Gehalt der Unschärferelation angeht. Handelt es sich hier lediglich um die Grenzen des Messbaren oder aber müssen den Teilchen tatsächlich unscharfe Zustände zugesprochen werden? Falls letzteres der Fall sein sollte, was würde das dann für die Freiheit eines Willen bedeuten? Es würde zweierlei bedeuten: Zum einen könnten materielle Zustände dann nicht mehr eindeutig und scharf beschrieben werden und dies würde die Frage aufwerfen, von was denn dann das Bewusstsein eine Begleiterscheinung sein soll. Der Epiphänomelismus wäre in die Pflicht einer Erläuterung gebracht und die Entstehung von Willen wäre zumindest innerhalb des Bewusstseinskonzeptes ein offener Diskussionspunkt. Zum anderen wäre das Konzept eindeutiger Kausalität berührt. Wenn man einen Zustand nicht scharf umschreiben kann, wie soll man dann seine Wirkung klar kennen? Dies würde, wie bereits der Aspekt der Wahrscheinlichkeit im Doppelspaltexperiment, einen Freiraum für die Wirkungsfreiheit von Willen eröffnen. Aber auch der methodische Ansatz des Reduktionismus wäre in Frage gestellt. Wenn nämlich in der Welt der kleinsten Teilchen Zustände nicht mehr scharf definierbar sind, dann kann es auch keine exakte Kenntnis dieser Zustände mehr geben und somit können auch makroskopische Zustände nicht mehr eindeutig abgeleitet werden. Tatsächlich gibt es Argumente dafür, dass die Unschärfe von Teilchen eine ontologische Eigenschaft von Materie ist und nicht bloß eine Einschränkung unserer Fähigkeiten als Messwerteerfasser. Da wäre zuerst der absolute Nullpunkt der Temperatur zu nennen. In der Physik wird Temperatur von Materie mit der mittleren Bewegungsenergie der Teilchen gleichgesetzt. Der abolute Nullpunkt der Temperatur wäre demnach die vollständige Bewegungslosigkeit aller Teilchen. Nach dem Unschärfegesetzt kann es aber einen absoluten Stillstand von Teilchen nicht geben. Denn: würde man für eine Menge von Teilchen messtechnisch den absoluten Nullpunkt der Temperatur festellen, so wüsste man gleichzeitig darüber, dass der Impuls der Teilchen 0 ist. Die Meßfehler des Impulses wäre damit ebenfalls 0 und somit ist die mathematische Formulierung der Unschärferelation nicht mehr erfüllbar: denn das Produkt aus dem Meßfehler des Impulses und dem Meßfehler des Ortes muß immer größer einer bestimmten Zahl sein. Es gibt aber keinen Faktor der gemeinsam mit einem Faktor 0 ein Produkt größer 0 erzeugen kann. Also darf zur Erfüllung der Unschärferelation der absolute Nullpunkt nicht erreichbar sein. Und er scheint es auch tatsächlich nicht zu sein. Die „Restemperatur“ der Materie scheint gerade so groß zu sein, dasss sie die Bedingungen der Unschärferelation erfüllt. Die Unschärfe scheint demnach eine ontologische Tatsache zu beschreiben und nicht bloß eine Einschränkung unser Fähigkeit Messungen vorzunehmen. Der Tunneleffekt ist ein weiteres Beispiel: Energie und Zeit sind ebenfalls über eine Unschärferelation miteinander verknüpft. Und wäre die Unschärferelation keine ontologische Tatsache, so würde die Sonne nicht leuchten. Denn: in der Sonne verschmelzen Wasserstoffkerne gemeinsam zu Heliumkernen. Dabei wird viel Energie frei. Jedoch erfolgt der Prozess nicht in einem Schritt sondern über mehrere komplizierte Zwischenschritte. Dass jedoch die Protonen zu Heliumkernen verschmelzen können, dazu müssen sie räumlich nahe genug aneinander geraten. Da aber alle Protonen eine positive elektrische Ladung haben, stossen sie sich mit einer starken Kraft ab. Nun genügt die Temperatur der Sonne nicht, dass die Bewegungsenergie der Protonen ausreicht, um die abstoßenden elektrostatischen Kräfte zu überwinden. Erst die Unschärferelation hilft weiter: je kleiner der betrachtete Zeitraum ist, desto stärker darf die Energie eines Teilchens von dem „eigentlich korrekten“ Wert abweichen. Und Rechnungen weisen aus, dass die formelmäßig beschriebene Unschärfe hierzu genau ausreicht um für kurze Zeiten die abstoßenden Kräfte der Protonen zu überwinden. Die Sonne kann nur deshalb leuchten, weil die Unschärferelation eine ontologische Tatsache widergibt. Die untenstehende Abbildung veranschaulicht noch einmal einen Charakterzug der Unschärferelation: Betrachtet man
das Muster einige Zeit, so wird man an den Kreuzungspunkten der weissen
Linien graue Flecken flimmern sehen. Versucht man jedoch einen solchen
grauen Fleck scharf mit dem Auge zu fixieren, so verschwindet er.
4.3 Der Welle-Teilchen DualismusDie oben beschriebenen Eigenarten der Quantenphysik passen nicht in das Bild der physikalischen Realität welches man mit dem Stichwort „Teilchenmodell“ bezeichnet. Die Vorstellung, dass die materielle Welt aus kleinsten Teilchen besteht und dass diese sich stetig durch Raum und Zeit bewegen und dass sie dabei über Kraftfelder oder direkten Stoß wechselwirken, diese Vorstellung passt nicht zu den Befunden der Quantenphysik. Es sind aber Teilchen, die wir wahrnehmen und messen. Wenn man Photonen auf eine lichtsensitive Platte schickt, so sieht man auf der Platte stets nur kleine Punkte aufblitzen, so als ob ein Teilchen aufgeschlagen wäre. Der Aufbau von Kristallgittern lässt sich als Anordnung teilchenartiger Atome erfolgreich beschreiben. Und Elektronen haben nachgewiesenermaßen eine Masse, man darf sie sich also als etwas stoffliches Vorstellen. Dieser intuitiv einggängigen Vorstellung widersprechen die Befunde der Quantenphysik. Wie soll ein Teilchen beschaffen sein, dem man keinen eindeutigen Ort oder Impuls zugestehen will? Was ist das für ein Lichtteilchen, welches im Doppelspaltversuch als Teilchen nur durch einen Spalt fliegt, aber Kenntnis haben muss über Lage und Beschaffenheit eines beliebig weit entfernten anderen Spaltes? In der Quantenphysik unterscheidet man gemeinhin zwei Zustände, zwei Seinsmodii sozusagen, von Materie: In unserem Bewusstsein nehmen wir Materie stets nur im Teilchenmodus wahr. Die Anwesenheit von Materie äußert sich über eng lokalisierbare Teilchen mit Masse. Und aufgrund der Grobheit unserer Sinnesorgane nehmen wir Veränderungen von Materie immer als stetig wahr. Und mit diesem Gefühl der Stetigkeit eng verknüpft ist unser Eindruck, dass ein vorlaufender Zustand mehr oder minder stark den daraus enstehenden neuen Zustand kausal bedingt. Dies ist der Teilchenmodus von Materie. Die Quantenphysik gibt nun in der Beschreibung der Veränderung materieller Zustände die Punktförmigkeit, die Stetigkeit und die Kausalität teilweise oder ganz auf. Die Quantenphysik verzichtet auf Aussagen, wie man sich Materie zwischen zwei beobachteten Zuständen überhaupt vorzustellen hat. Die Quantenphysik beschränkt sich darauf, statistische Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, die zwei beobachtete Zustände miteinander verbinden. Was dazwischen passiert, darüber macht die Quantenphysik keine Aussage. Sie belässt solche Aussagen in dem Bereich außerhalb ihres Erkärungsanspruches. In der quantenphysikalischen Sicht kann ein Teilchen nach einer Beobachtung als Wahrscheinlichkeitsfeld beschrieben werden. Unabhängig von der materiellen Existenz des Teilchens existiert nun ein mathematisch beschreibbares Feld welches sich in Raum und Zeit verändert. Die mathematische Anwendung dieses Feld liefert eine Aussage darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit das vorher beobachtete Teilchen in einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Raumelement angetroffen werden kann. Mehr nicht. Um zu wissen, ob dann ein Teilchen tatsächlich in einer bestimmten Umgebung und einer bestimmten Zeit ankommt, dazu muss man dann erneut eine Messung durchführen. Das heisst, man muss den in Frage stehenden Raum in dem interessierenden Zeitabschnitt beobachten. Weil das mathematische Formelwerk zur Beschreibung dieser Wahrscheinlichkeitsfelder an mathematische Beschreibung von Wellen erinnert, nennt man die Wahrscheinlichkeitsfunktion auch oft Wellenfunktion. Und die Koexistenz dieser beiden Beschreibungsformen von Materie bezeichnet man prägnant als Welle-Teilchen-Dualismus. Die folgenden Skizzen sollen den Dualismus von Wellen-Teilchen veranschaulichen.
Halten wir also fest, dass sich Materie in einer Beobachtung stets im Teilchenmodus offenbart, dass aber zur Beschreibung dessen was zwischen den Beobachtungen passiert keine mathematische Beschreibung gefunden werden kann, die das Teilchenmodell befriedigt. Die mathematische Beschreibung dessen, was zwischen Beobachtungen passiert fußt auf den Annahmen der Unstetigkeit, der Wahrscheinlichkeit und einer Art holistischen Wissens über weit entfernte Gegenstände. 5 Freier Wille und Quantenphysik: das BewusstseinWir haben oben gesehen, dass die Quantenphysik an verschiedenen Stellen das streng deterministische Weltbild der klassischen Physik wirksam hinterfragt. Damit eröffnet sich ein Interpretationsraum für Spekulationen über die Freiheit von Willen. Eine Reihe von Autoren mit naturwissenschaftlichem Hintergrund (z. B: Penrose, Eccles, Popper, Arendes, Norretranders, Stapp) haben nun versucht, die Freiheit individuellen Willens konzeptionell mit Phänomenen der Quantenphysik zu verbinden. Dabei werden vielfach auch Betrachtungen über das Phänomen des Bewusstseins benutzt. In diesem Kapitel soll gezeigt werden warum. Unser unmittelbares und beharrliches Empfinden eigenen Seins, unser Selbstbewusstsein, war und ist eine beständige Quelle des Zweifels an der Gültigkeit eines klassisch-deterministischen Weltbildes wie oben vorgestellt. Denn wozu soll die Empfindung von Emotionen, von sich selbst, von Bewusstseinsinhalten gut sein in einem Weltbild, in dem alles über Formeln geregelt werden kann? Was ein Mensch tut, das tut er einzig und alleine als Ergebnis seiner materiellen Historie. Er tut es, weil die Hormone in seinem Gehirn gerade so und nicht anders verteilt sind, weil manche seiner Synapsen gerade so und nicht anders gewichtet sind und er tut es, weil seine genetische Ausstattung ihm eine Neigung dazu verliehen hat. Wozu dient also dann das Bewusstsein? Warum müssen wir Schmerz empfinden, wenn wir uns verbrennen? Der Reflex, das verbrannte Glied zurückzuziehen funktioniert genauso wie ein Lidschlagreflex auch ohne begleitende Empfindung. Und wozu müssen wir Hunger, Sehnsucht, Angst oder Agression empfinden, wenn die begleitenden Handlungen doch voll und ganz als materialistisch interpretierbares und konsequentes Ergebnis evolutiven Geschehenes gedeutet werden könnnen? Das Bewusstsein, in dem wir ja auch unseren Willen empfinden, ist in einem materialistischen Weltbild überflüssig. Es ist aber gerade das Bewusstsein welches die Existenz einer Welt des Geistigen und des Wollens andeutet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sah man allerdings keine wissenschaftlich zu rechtfertigende Verknüpfung von Konzepten des Bewusstseins einerseits und Konzepten der Naturwissenschaften andererseits. Solche Verknüpfungen zwischen der materiellen Welt und dem Bewusstsein liefert jedoch die Quantenphysik. Denn einige Eigenschaften der Quantenphysik scheinen auch Eigenschaften des Bewusstseins zu sein: Manche Interpreten der Quantenphysik (Kopenhagener Deutung) bringen den Akt der bewussten Wahrnehmung damit in Verbindung, wann der Wahrscheinlichkeits-Modus eines Teilchen übergeht in den Teilchenmodus. Es sind also Physiker, die auf einmal einen Einfluss geisteswissenschaftlich beschriebener Phänomene auf materielle Abläufe postulieren. Der nonlokale Holismus quantenphysikalischer Wahrscheinlichkeitsfunktionen ähnelt dem integrierenden Holismus von Bewusstseinszuständen im Verhältnis von materiellen Zuständen des Gehirns. Manche bewusste Operationen des menschlichen Geistes lassen sich vielleicht nicht algorithmisieren; sie sind nicht in endlicher Zeit durch rein materielle Abläufe darzustellen. Auch quantenphysikalische Einzelzustände lassen sich weder mathematisieren noch präzise erfassen. Es besteht hier eine vage Korrelation einer gewissen Mystik des Unbeschreiblichen. Bewusstsein und freier Wille sind in einem deterministischen Weltbild überflüssig beziehungsweise widersprechen diesem. Die Quantenphysik allerdings zweifelt die Grundpfeiler dieses deterministischen Weltbildes an. Insbesondere die Aufhebung strikter Kausalität durch die Unschärferelation sowie der Wahrscheinlichkeitscharakter von Wellenfunktionen ist hier zu nennen. Verschiedene Autoren nehmen nun solche eher assoziativen Gedankenbrücken zwischen der Quantenphysik einerseits sowie der Bewusstseinsforschung und dem Wunsch nach einer Willensfreiheit andererseits zum Anlass zu Spekulationen über funktionale Wechselwirkungen zwischen Materie und Geist. 6 InterpretationsbeispieleIn diesem Kapitel werden beispielhafte Versuche vorgestellt, die Befunde der Quantenphysik mit geisteswissenschaftlichen Konzepten zu verknüpfen. 6.1 Roger PenroseDer Physiker und Mathematiker Roger Penrose geht ausdrücklich von einer realen Existenz platonischer Ideen - zumindest mathematischer Art - aus. In seinem Buch "Computerdenken" widmet er dem Kontakt mit diesen Ideen ein eigenes Kapitel und beschreibt seine eigene Wahrnehmung mathematischer Formeln explizit in der Form einer Wiedererinnerung an platonische Ideen. Diesem Kapitel vorangestellt sind weitläufige Überlegungen zur Funktion des menschlichen Gehirns und eine Beschreibung der Tatsache, dass einzelne nicht-determinierte Quantenereignisse den Gang der Gedanken in menschlichen Gehirnen beeinflussen könnten. Penrose bringt also explizit die nicht-Kausalität von Quantenereignissen mit einer Wirkung platonischer Ideen in Zusammenhang. Bei seiner Untersuchung des Phänomens des Bewußsteins charakterisiert er unbewusste Denkvorgänge als "automatisch, gedankenloses Befolgen von Regeln, programmiert, algorithmisch" und grenzt sie ab gegen bewusste Denkvorgänge, die charakterisiert seien durch "gesunden Menschenvestand, Wahrheitsurteil, Verstehen, künstlerische Wertung". Er schreibt: "Ich meine daher, daß unbewußte Hirntätigkeiten gemäß algorithmisches Prozesse ablaufen, während die Tätigekit des Bewußtseins davon ganz verschieden ist und in einer Weise vor sich geht, die durch keinen Algorithmus beschrieben werden kann." Und: "Das Bilden von Urteilen, das ich für ein Wesensmerkmal von Bewußtsein halte, ist an sich selbst etwas, von dessen Programmierung auf einem Computer die KI-Forscher keinen Begriff haben." Sowie: "Ich behaupt hier, daß gerade diese Fähigkeit, unter passenden Umständen Wahr von Falsch (und Schönheit von Häßlichkeit!) `intuitiv´ unterscheiden zu können, das Wesensmerkmal von Bewußtsein ausmacht.“ Für Penrose ist gerade der bewusste Geist etwas klar gegen algorithmisierbare, das heisst rationalisierbare Logik, abgenzbares. Und Penrose verknüpft diese Eigenart des Bewusstseins mit gewissen Eigenschaften der Quantenpyhsik. 6.2 Henry Stapp
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||